Im Mittelalter wurde Afrika als Europa ebenbürtig angesehen. Heut ist das anders. Warum? Sozialanthropologiestudentinnen aus Wien gehen in einem Buch dem “Spuk des Fremden” auf den Grund.
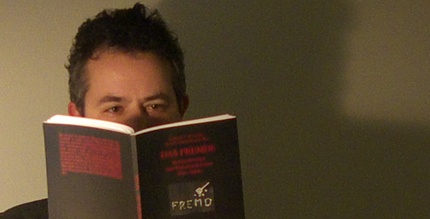
“Das Fremde. Konstruktionen und Dekonstruktionen eines Spuks” ist Resultat eines Seminars an der Uni Wien. Anhand von Beispielen aus der Politik, Werbung und Geschichte zeigen die Autorinnen auf, wie wir das Fremde konstruieren, wie wir Fremde behandeln und wie wir uns eventuell vom “Spuk des Fremden” befreien können.
Ende letzten Jahres hatte ich mich mit den beiden Redakteurinnen Stephanie Krawinkler und Susanne Oberpeilsteiner über das Buch unterhalten. Kurz danach landete das Buch in meinem Briefkasten. Ich habs es nun gelesen.
Es ist ein gutes Buch. Es gibt eine gute Einführung in ein zentrales Thema unseres Faches, in Theorien (oder Ideologien) wie die des Multikulturalismus und in die Diskursanalyse, ein grundlegendes Handwerkzeug für jeden Gesellschaftswissenschaftler. Lediglich sprachlich hapert es gelegentlich: Die teils langen Zitate auf Englisch hemmen de Lesefluss und aufgrund des Fachjargons sollte man ein paar Semester studiert haben, um vom Buch profitieren zu können.
Besonders gut gefällt mir die kritische Einstellung zur populären Gleichsetzung von Nationalität und Kultur. Ob jemand als fremd aufgefasst wird, hängt nicht unbedingt mit der Nationalität zusammen. Auch ohne Migranten existiert in Österreich und anderen Länderm eine Vielfalt von Lebensformen und Werten.
“Ein Fremder", schreibt Caroline Purps im Einstiegskapitel, “ist nicht einfach fremd, er wird zu dem Fremden gemacht.” Wer zu Fremden gemacht wird und wie diese Fremde behandelt werden, hat nicht unbedingt mit den Eigenschaften der jeweiligen “Fremden” ("ihrer Kultur") zu tun, sondern mit der politischen Grosswetterlage, mit Machtverhältnissen, Interessen der dominierenden Gesellschaftsschichten.
Um Fremde und Fremdheit zu verstehen, muss man daher die Mehrheitsgesellschaft studieren. Hier ist die Diskursanalyse, die Purps vorstellt, ein nuetzliches Werkzeug:
Überzeichnet gesagt: Wer den Diskurs bestimmt, kann Realität schaffen. Während also die Mehrheitsbevölkerung im Alltagsdiskurs meint, mit zwingenden Tatsachen zu hantieren, stellt die Critical Discourse Analysis das in Frage. Ein Fremder ist nicht einfach fremd, er wird zu dem Fremden gemacht. Und Angehoerige einer bestimmten Minderheit sind nicht einfach anders, sie werden zu den Anderen gemacht.
Dies ist eine wichtige Erkenntnis. Zur Zeit sind Muslime die Fremden. Zu Fremden Nr 1 gemacht durch 9/11 und USAs “Krieg gegen Terror". Fremdbilder ändern sich. Hier in Norwegen z.B. wurden vor hundert Jahren die Schweden ähnlicher Hetze und Diskriminierung ausgesetzt wie Muslime heutzutage - etwas das sich heute niemand vorstellen kann.
Auch das Bild von Afrika hat sich gewandelt. Aufzeichnungen aus dem Mittelalter zufolge, so Stefan Weghuber in seinem Beitrag, hatten Europäer hohen Respekt vor Afrika. Afrika galt als Europa ebenbürtig. Dies änderte sich mit der europäischen Expansion und den Kreuzzügen. Afrikaner wurden als primitiv dargestellt, um Missionierung und Kolonisierung zu legitimieren. Während des Zweiten Weltkriegs charakterisierten die Nationalsozialisten Marokkaner, die in der französischen Armee Dienst taten, als “Kannibalen".
Dieses Bild von Afrikanern bekamen jene österreichischischen Frauen zu spüren, die Beziehungen mit marokkanischen Besatzungssoldaten, die gegen Ende des Zweiten Weltkrieges u.a. in Vorarlberg einmarschierten, eingingen. Marokkaner wurden - im Gegensatz zu den französischen Soldaten - als “Naturmenschen” oder “Kulturlose” angesehen. Sich mit “solchen Leuten” zu verheiraten, galt als Unding. “Lassen Sie sich nie mehr in der Kirche blicken", sagte ein Pfarrer zu einer dieser Frauen, die mit einem Marokkaner ein Kind hatte.
Auch bei dieser Begegnung spielten “die Bewertungen und Interpretationen eines vorkonstruierten Fremden eine entscheidende Rolle", kommentiert Weghuber.
Fremdbilder werden ständig neu geschaffen - z.B. auch in der Werbung, wenn Fanta mit ihrem Bamboocha-Werbespot aus dem Jahre 2005 (und der begleitenden Kampagne) Klischees aus der “paradisischen Südseewelt” aufgreift, wie dies Hanna M. Klien in ihrem Artikel schildert:
(deutsche Version nicht mehr auf Youtube)
Auch hier sagt der Diskurs über die “Anderen” mehr aus über die Mehrheitsgesellschaft als über die “Fremden". Mithilfe eines psychoanalytischen Zugangs zeigt Klien, dass die Werbung darauf abzielt, Wünsche, die in unserer (kapitalistischen) Gesellschaft kein Platz haben und daher verdrängt werden, anzusprechen. Spass, Strand und Sonne statt Arbeit! Fanta machts möglich!
Das Resultat ist eine “durch rassistisch und exotisch gepraegte Stereotypen” dargestellte Südseebevölkerung. Die beiden Männer im Werbespot (Jimmy und Little Budda) werden “vor allem durch ihre Naivität, Unbedachtheit und die positive Lebenseinstellung charakterisiert", so Klien.
Diese Perspektive auf “das Fremde” oder “die Fremden” als Konstrukt ist ein wichtiges Korrektiv zu gegenwärtigen Diskursen, in der Praxisen der Mehrheit selten kritisch analysiert werden. Viele dieser Diskurse basieren auf der Theorie oder Ideologie des Multikulturalismus, welche die Welt als eine Ansammlung verschiedener in sich geschlossener, homogener Kulturen sieht.
Susanne Oberpeilsteiner zeigt auf, dass Multikulturalismus - obwohl es verschiedene Versionen davon gibt - nicht unbedingt eine gute Lösung im Umgang mit “Fremden” ist. Sie zitiert u.a. Frank-Olaf Radtke der meint dass “kulturelle Differenz als Legitimation für den fortbestehenden Sonderstatus der Migranten weiterbenutzt” werde. Multikulturalismus, so Radtke, reproduziere genau die Kategorien, die überwunden werden sollen. Menschen wuerden ausschliesslich mit ihrer “Herkunftskultur” identifiziert. Die “Fremden” bekämen keine Chance, dem “Eigenenen” ähnlich zu werden; sie würden immer “fremd” bleiben.
Sehr verbreitet ist instrumenteller Multikulturalismus: Man anerkennt das Fremde solange es einem selbst nutzt, die Gesellschaft “bereichert” und leicht konsumierbar ist. Wer hat schon etwas gegen indisches Essen oder kubanische Rhythmen? Anders verhält es sich mit dem Hijab, ein komplexes Thema, das nicht auf Anhieb verstanden werden kann und daher gerne abgelehnt wird (Thomas Hylland Eriksen spricht von “diversity versus difference“).
Solche Haltungen hat Aleksandra Kolodziejczyk in der Wahlwerbung der SPÖ für die Wiener Landtagswahlen 2005, das sie für das Buch analysiert hat, entdeckt. Die Sozialdemokraten operieren mit zwei Kategorien von Fremden, den erwünschten und den unerwünschten Fremden ("ZuwanderInnen").
Die Ethnologin schreibt:
Wünschenswerte Elemente des multikulturellen Erlebnisses sollen hervorgehoben werden, unerwünschte Teile des Fremden assimiliert und bestehende Konflikte und Reibungsflächen ausgeblendet werden.
(…)
Die unerwünschten Fremden sollen ausgegrenzt werden, die Erwünschten, die bereits einen sicheren Aufenthaltsstatus besitzen, sollen sich integrieren und sich konform mit den geltenden Gesetzen und sozialen Normen verhalten. (….) Die Verbesserung des Rechtsstatus und der Bedürfnisse von Zugewandterten mit prekären Aufenthaltsbedingungen werden nicht thematisiert.
Grosses Interesse an “Fremdem” konnte sie nicht entdecken, eher bevormundende und moralisierende Aussagen:
Solidarität zwischen den Menschen wird propagiert, weil “alle Fortschritte (…) niemals blind machen (dürfen) für die Schwächeren, die nicht mitkönnen". (…) Die Sozialdemokraten zaehlen alle zugewandterten Personen zu den Schwachen und Hilfsbeduerftigen. Anstatt MigrantInnen als handelnde und gleichberechtigte InteraktionspartnerInnen wahrzunehmen, werden sie als KundInnen der SPÖ in eine hierarchisch unterlegene Position gebracht.
Welche Alternativen gibt es?
Weniger paternalistisch und mit mehr Offenheit scheint eine oesterreichische Bank dieses Thema anzugehen. Stephanie A. Krawinkler stellt das sogenannte “Diversity Management” der BA-CA (Bank Austria Creditanstalt) vor. Obwohl auch die Bank etwas stereotyp mit Vorstellungen einer “Nationalkultur” umgeht, berücksichtigt sie auch Vielfalt in Bezug auf Alter, Gesundheitszustand und sogar “Lebensweise” (Familienform, sexuelle Orientierung, “Work-Life-Balance"). Das ist eine ganz andere Haltung zu Vielfalt als ich in meinem ersten “richtigen” Job erfuhr. Schnell merkte ich, dass ich mit meinem Ethnologie-Background nur schlecht in die Gemeindeverwaltung hineinpasste. Als ich meinen Chef fragte, ob es moeglich sei, die Stelle meinen Qualifikationen anzupassen, wurde er wütend. Ich hatte meinen Chef niemals zu wütend gesehen.
Als Alternative zu einem essentialistischen Multikulturalismus schlägt Susanne Oberpeilsteiner Wolfgang Welschs Konzept der “Transkulturalität” vor. Dies trage der “Vernetztheit der Kulturen” Rechnung, schreibt sie. Schön wäre noch ein Durchgang der wachsenden anthropologischen Fachliteratur zum Kosmopolitismus gewesen.
SIEHE AUCH:
Interview: Neue Blicke auf “das Fremde” - Sozialanthropologie-Studentinnen geben Buch heraus
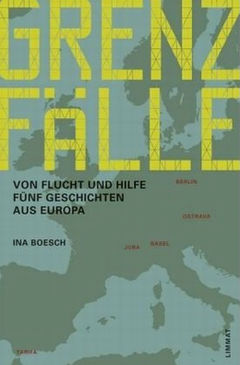
Neueste Kommentare