Wie viel Zusammenhalt braucht eine Gesellschaft? Wie viel Segregation (v)erträgt sie? Bereits im letztem Jahr ist Werner Schiffauers Buch “Parallelgesellschaften” herausgekommen. Erst jetzt wurde es in einer Zeitung, dem Standard, besprochen.
In diesem Buch zeigt der Ethnologe dass das Beharren auf die Notwendigkeit gemeinsamer Werte das Zusammenleben mit Menschen aus anderen Ländern erschwert. Er weist nach, dass gesellschaftliche Solidarität auch entstehen kann, wenn es grosse kulturelle Unterschiede innerhalb einer Gesellschaft gibt. Notwendig ist ein Klima, das kulturellen Austausch fördert.
Die Besprechung im Standard ist allerdings allzu kurz. Bessere Arbeit hat Süleyman Gögercin auf socialnet.de geleistet. Der Pädagogik-Professor aus Villingen-Schwenningen geht das Buch Kapitel für Kapitel durch und stellt auch die drei Fallstudien, auf denen das Buch basiert, vor. “Ein Ehrdelikt - Zum Wertewandel bei türkischen Einwanderern", “Die islamischen Gemeinden in der »Parallelgesellschaft«", und “Großstädtische Identifikationen".
Gögercin zufolge räumt Schiffauer mit vielen gängigen Vorstellungen auf, z.B. dass islamische Gemeinden Integration verhindern. Schiffauer zeigt auch, dass man sich nicht deutsch fühlen muss, um integriert zu sein. Auch wenn sich gewisse Nachkommen von Einwandern ("2. und 3. Generation der Migranten” - sind ja eigentlich keine Migranten) nur wenig mit Deutschland identifizieren, so bejahen sie die Stadt, in der sie leben. Sie identifizieren sich mehr mit der Stadt als mit der Nation. “Ich bin ein Berliner", sagen sie stolz.
So abgeschlossen und “modernisierungsresistent” wie es mange glauben, seien Stadtteile mit hohem Migrantenanteil nicht. Es herrscht eine grosse Vielfalt, und “Parallelgesellschaften” stellten sie nicht dar.
Eine kulturell integrierte Gesellschaft, so Schiffauer, zeichnet sich nicht dadurch aus, dass alle Einwohner sich zu den gleichen Werten bekennen. Wichtiger sei, “dass es fließende Übergänge, Überkreuzungen und Überschneidungen", also eine kulturelle Vernetzung, gäbe. Deshalb brauchen wir “eine kluge Politik der Differenz".
“Eine Politik, der an gesellschaftlichem Zusammenhalt liegt, wird einen offenen Austausch mit allen Gruppierungen anstreben, die innerhalb der Gesetzesordnung agieren und sie darüber kommunikativ einbinden.” (S. 123) Diese “Politik der Einbindung nutzt das Potenzial von pluralen kulturellen Zugehörigkeiten und Loyalitäten bei der Gruppe der ‚anderen Deutschen’ und vermeidet Eindeutigkeitszwänge.” (S. 125)
Das Beharren auf die Notwendigkeit einer “Leitkultur” und das ewige Gerede über “Parallelgesellschaften” verringere die Chancen solidarischen Zusammenlebens:
“Gerade wenn man den Gedanken teilt, dass Kultur eine wichtige Rolle für den Integrationsprozess und für den gesellschaftlichen Zusammenhalt spielt, ist man gut beraten, den Gedanken der Leitkultur aufzugeben und ihn durch den Gedanken der kulturellen Vernetzung zu ersetzen, der in jeder Hinsicht einer offenen und freiheitlichen Gesellschaft angemessener ist.” (S. 138)
>> Besprechung im Standard
>> Besprechung auf socialnet.de
Der Transkript-Verlag hat eine informative Seite über das Buch erstellt (inkl Mini-Interview). Auf Schiffauers Uni-Webseite kann man sich eine Unmenge von Texten von ihm herunterladen.
Schiffauer scheint übrigens auf alle meine Fragen zu antworten, die ich in meinem Text über die Leitkulturdebatte “Wieviel Zusammenhalt braucht eine Gesellschaft?” stelle
SIEHE AUCH:
Schiffauer: “Man sollte ein Bekenntnis zum Grundwertekatalog verlangen”
Schiffauer: “Öffnung gegenüber dem Islam nicht der Terrorismusbekämpfung unterordnen”
Einwanderung, Stadtentwicklung und die Produktion von “Kulturkonflikten”
Schule, Integration und Kosmopolitismus
Buchbesprechung: Unser merkwürdiger Umgang mit “Fremdem”
What holds humanity together? Keith Hart and Thomas Hylland Eriksen: This is 21st century anthropology
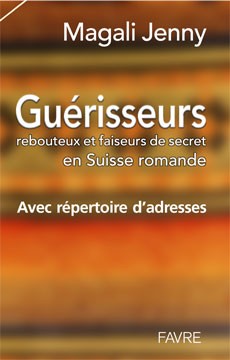
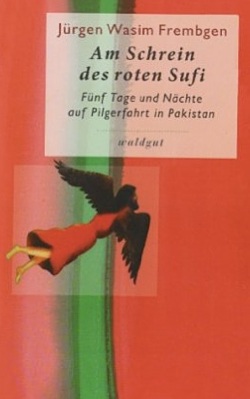
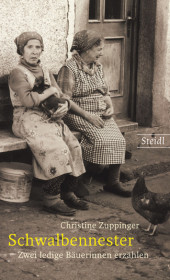

Neueste Kommentare