
Militaristisch, historisch mahnend oder Tourismusattraktion? Das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig. Foto: Mike TheG-Forcers, flickr
Ein unwohles Gefühl befiel mich, als ich mir vor vielen Jahren das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig anschaute. Ähnlich ist es den EthnologInnen Friedemann Ebelt und Theresa George ergangen, als sie das Denkmal kürzlich besuchten um sich das Reenactment der Völkerschlacht bei Leipzig anzusehen.
Diese Nachstellung der Schlacht fand anlässlich des Doppeljubiläums 200 Jahre Völkerschlacht - 100 Jahre Völkerschlachtdenkmal statt. Durch zahlreiche Veranstaltungen sollte das Völkerschlachtdenkmal zu einem Mahnmal der Leiden des Krieges und zu einem Symbol des europäischen Zusammenlebens werden.
Im folgenden Beitrag zeigen die EthnologInnen, wie bei dieser lebendigen Geschichtsdarstellung stattdessen der Geist des Militarismus aufs Neue zum Leben erweckt wurde.
Vom Krieg besessen: Was passiert, wenn Schlachten zu lebendiger Geschichte werden
Von Friedemann Ebelt und Theresa George

Im Oktober verbrachte ich mit der Ethnologin und Filmemacherin Theresa George anlässlich der Gedenkwoche zum 200. Jahrestag der Völkerschlacht bei Leipzig vier Tage in der Messestadt. Mit Kamera und Bleistift wollten wir herausfinden, worum es bei der Lebendigmachung von Geschichte im Kern geht. Aus ethnologischer Perspektive handelt es sich um eine Geisterbeschwörung.
1813 lassen in der Völkerschlacht bei Leipzig unzählige Soldaten ihre Leben und ihre Körper auf den Schlachtfeldern. Aus den toten Körpern steigt ein Kriegsgeist empor, der über 200 Jahre hinweg immer wieder lebendig gemacht wird. 100 Jahre nach der Völkerschlacht wird diesem Geist mit der Errichtung des Völkerschlachtdenkmals ein ewiger Körper aus Stein gemauert.
Der Geist von 1813 zieht in das Bauwerk ein. Seit dem haust er dort in der Gestalt der Vorstellung, dass die nationale Geschichte Deutschlands eine militärische Leistung sei. Für die Ahnen der 1813 getöteten Soldaten wird das Völkerschlachtdenkmal ein priviligierter Ort, an dem sie den Geist des Krieges und des Militarismus beschwören. 1913 führt dieser Geist wieder Menschen in Soldatenuniformen in den Ersten Weltkrieg. 1933 fährt der Geist des Militarismus in die Fackeln und Fahnen der Nationalsozialisten und nach dem Zweiten Weltkrieg beseelt er die Insignien der Nationalen Volksarmee.
Der brasilianische Ethnologe Eduardo Viveiros de Castro schreibt über religiösen Ahnenkult und die vielen Körper des Geistes: „Die Geistige Identität überschreitet die körperliche Schranke des Todes, die Lebenden und die Toten sind ähnlich, solange sie vom selben Geist beseelt sind – das »über-menschliche« Ahnentum und die geistige Besessenheit einerseits und (…) die körperliche Metamorphose andererseits“.
Zweihundert Jahre nach der Schlacht, also im Jahr 2013 wird der Versuch unternommen den Geist des Krieges mit einer Gedenkwoche zu befrieden. Durch zahlreiche Veranstaltungen soll das Völkerschlachtdenkmal zu einem Mahnmal der Leiden des Krieges und zu einem Symbol des europäischen Zusammenlebens werden.
In Podiumsgesprächen werden Vergangenheit und Zukunft Europas, der Wert des Friedens aber auch die Schrecken und Details der Schlacht von 1813 diskutiert. In Friedensgebeten und Gottesdiensten wird den Toten der Kriege gedacht. Ausstellungen zeigen Gemälde, Artefakte und Zeitdokumente. Im Inneren des Völkerschlachtdenkmals können Interessierte an Spezialführungen teilnehmen und außen wird Europa und der Frieden mit Sportveranstaltungen, Konzerten, Lichtshows und Feuerwerk gefeiert.
Doch der Geist des Militarismus lässt sich nicht vertreiben. Er wird während der Gedenkwoche aufs Neue zum Leben erweckt. Die eindrücklichste Verkörperung des Geistes ist die militärhistorische Nachstellung der Völkerschlacht bei Leipzig. Vier Tage lang werden Schlachtfelder ausgebreitet und Kanonen herbei gerollt. 6000 Menschen in historischen Uniformen verleihen dem Geist der Schlacht von 1813 einen neuen Körper. Die HobbyhistorikerInnen beschwören ihn mit ihren originalgetreuen Waffen, ihrem authentisch militärischem Verhalten und ihrem Interesse für die Geschichte Europas als Militärgeschichte.
Gesagt wird, dass es sich um ein legitimes historische Interesse handelt, wenn Geschichte zum Anfassen inszeniert wird - und das ist auch wahr. Aber wenn Hobbysoldaten und Publikum bei Gesprächen über militärische Tötungsakte und Schlachtstrategien eine gruselige Freude empfinden und wenn Kinder in ihrem Kriegsspiel die Kriegsbegeisterung ausleben, die die Disziplin der uniformierten Erwachsenen unterbindet – geht es nicht um Interesse an Geschichte, sondern es wird der Geist des Militarismus belebt.

Warum marschieren die todbringenden und gleichzeitig todgeweihten Körper in ihren Uniformen statt auf ein Schlachtfeld nicht auf einen symbolischen Friedhof um ihre Waffen, Abzeichen und Uniformen niederzulegen? Foto: Friedemann Ebelt und Theresa George
Der harmlose Krieg
Im Gegensatz zu 1913 stehen 2013 keine Soldaten am Völkerschlachtdenkmal, die auf einen kommenden Krieg eingeschworen werden. Stattdessen wird der Geist des Militarismus mit flachem Puls und vielleicht auch durch Unaufmerksamkeit zum Leben erweckt.
Es droht keine Kriegsbreitschaft, aber die Bajonette glänzen in der Sonne und die Soldaten lächeln mit faisten Wangen. Kein Blut, keine Schreie und kein Tod. Die Inszenierung der Hobbysoldaten kann als Geschichtvermittlung gelten, weil die Kostüme, die Waffen und das Verhalten authentisch erscheinen.
Plausibel ist dieses Schauspiel trotzdem nicht, denn die Geister der Verhungerten und Erkrankten, die Geister der Soldaten, deren Uniformen an ihrer Haut schimmelte und all die Geister von den verkrüppelten, traumatisierten und krepierten Menschen werden nicht verkörpert. Es geht auch nicht, dass in den Gassen der historischen Dörfer stinkende, schreiende und tote Körper liegen, denn dann würden keine Zuschauer kommen und die OrganisatorInnen der friedlichen Schaugefechte könnten sich nicht historisch überlegen zum kriegerischen Jahr 1813 fühlen.
Allen, die Spektakel einer lebendigen Geschichte organisieren ist bewusst, dass erlebbare Geschichte nur möglich ist, weil die historischen Zustände nicht erlebbar gemacht werden. Stattdessen basiert die Belebung von Geschichte auf einer romantischen Reinigung von Brutalität und Schönheit. Diese Reinigung ist notwendig, damit der Terror des Kriegs als Veranstaltungswoche genossen werden kann. Die Reinigung gelingt in Leipzig im Oktober 2013 aber nicht vollständig, weil sich der Terror aus Bajonetten und Kanonen nicht zurückzieht, nur weil das Kriegsgerät nicht zum tödlichen Einsatz gebracht wird.
Dass diese Reinigung eine abenteuerliche Gratwanderung ist, wird offensichtlich, als der Moderator ein Schaugefecht mit den Worten „Trotz des eigentlich traurigen Anlasses – Gute Unterhaltung!“ eröffnet. Nach dem Artilleriedonner ist das Spektakel zu Ende: „Wir danken den Kanonieren mit großem Applaus!“ In diesen Veranstaltungen erfährt das Publikum Details zu den Waffengattungen, zu den Kampftaktiken und zum Kampfgeschehen.
Als Teil des Publikums erfuhr ich auf wie viele Meter welche historische Waffengattung tödlich ist. Ein Mann mit seinem Sohn an der Hand schwärmt einem Freund mit glänzenden Augen vor: „Die haben sich Auge in Auge gegenübergestellt und sich abgeschlachtet.“ Vor einem Zelt im Biwak: Ein Hobbysoldat in der Uniform der preußischen Landwehr von 1813 salutiert mit seiner Mütze und ruft den vorbeigehenden Soldaten entgegen: „Euch Tod und ewige Verdammnis!“. Noch vor wenigen Stunden sagte dieser Mann, dass hier alle Freunde seien und man sich prächtig verstehe.
Ermöglicht es eine historische Rolle, einem Freund Tod und ewige Verdammnis zu wünschen? In solchen Momenten wird der Geist des Militarismus lebendig und weil die nachgestellten Gefechte scheinbar einem aufklärerischen historischen Interesse dienen, wird es möglich den Militarismus zu genießen.
In der Mittagspause marschieren fünf Hobbyhistoriker in Uniform in einen Asia-Imbiss ein. Beim Anstoßen mit deutschem Bier, denn das asiatische macht Schlitzaugen, wird ausgerufen:„Gott schütze Preußen!“ Erlebbare Geschichte und erlebbare Gegenwart verschmelzen unter den Kostümen, die dann keine mehr sind. Die Soldatenrolle wird in der Mittagspause nicht verlassen - weil sie nicht nur eine gespielte Rolle ist.
De Castro schreibt: „Eine Kleidung-Maske zu tragen, bedeutet weniger eine, menschliche Essenz (…) zu verbergen, als Mächte eines anderen Körpers zu aktivieren“. Diesem Gedanken weiter folgend sind die historischen Uniformen „keine Verkleidungen, sondern Instrumente: Sie ähneln den Taucherausrüstungen (…) nicht den Fasnachtsmasken. Wer einen Taucheranzug anzieht, beabsichtigt, wie ein Fisch funktionieren zu können, und nicht, sich unter einer eigenartigen Form zu verstecken“.
Beim Waffenputzen, Singen oder Kanonenabfeuern entstehen Momente in denen die vernünftige Gefasstheit der lebendigen Geschichte verlorengeht. Ein scheinbar sachlich-historisches Interesse weicht der Faszination der Macht durch Waffengewalt.
Während unseres Besuchs der Gedenkwoche fragen wir uns, wie es sich für die Hobbysoldaten anfühlt, wenn sie sich während eines Angriffs in der historischen Gefechtsdarstellung totspielend zu Boden fallen lassen. Und: Wie fühlt es sich auf der anderen Seite an, das originalgetreue Gewehr zu laden, auf die historischen Feinde zu richten und abzufeuern um dann zu sehen, dass jemand zu Boden fällt?
Mit dem Buch Im Rausch des Rituals , das die Ethnologen Klaus-Peter Köpping und Ursula Rao 2000 herausgegeben haben, sind die Szenen der Gefechte als kollektive kulturelle Performanzen zu verstehen, in denen Werte ausgedrückt, bestätigt und in Körper eingeschrieben werden.
Kinder und die Freude am Kriegspielen
Nachdem wir dem Geist des Militarismus auf die Spur gekommen waren, fragten wir uns, ab wann seine Erweckung problematisch wird. Beim Blättern in unseren Notizheften und beim Anschauen von Fotos wurde uns klar, dass der Geist des Militarismus nicht nur Erwachsene ergreift, sondern auch in Kindern lebendig wird.
Eltern tragen ihre Kinder auf dem Arm an die Pferde der Soldaten heran, damit die Kleinen die Tiere streicheln können. Im Hintergrund reiten Kavalleristen vorbei und Kinder galoppierten mit Steckenpferden hinter den berittenen Soldaten her.

Wieso stört es die Erwachsenen nicht, wenn ihre Kinder zu Soldaten werden? Foto: Friedemann Ebelt und Theresa George
Eine andere Szene: Sechs Hobbysoldaten proben Wachablösung in einem historischen Dorf. Ein Kind betrachtet die Szene und schießt mit seinem Stockgewehr auf die Soldaten und in das Publikum. Wenn ein kleiner Junge vor Soldaten, die eine Wachablösung proben, Krieg empfindet und mit seinem Körper das Abfeuern eines Gewehres spielt und dabei auf Menschen zielt, ohne, dass irgendjemand etwas sagt, dann verkörpert dieser Junge die Freude, die die Hobbysoldaten empfinden, wenn sie auf ihrem Schlachtfeld stehen.
Anders gesagt, haucht in dieser Szene ein Hobbyoffizier als Ritualmeister beim Üben einer militärischen Wachablösung seinen Hobbysoldaten den Geist des Krieges ein, der auch in das zuschauende und mitmachende Kind fährt. Der Unterschied ist, dass das Kind im Gegensatz zu den Wachen diesen Geist nicht diszipliniert, geheimhält, oder versteckt.
Am Abend marschiert dann ein Trupp von vielleicht 20 Soldaten im Gleichschritt durch den Biwak ihrer historischen Gegner. Einhundert Meter weiter spielen ein paar Kinder mit Stöcken und Steinen Infanterieangriff vor den Biwaks der großen Hobbysoldaten. Ein kleiner Junge sitzt auf den Schultern seines Vaters und senkt am ausgestreckten Arm einen Stock wie ein Kavallerist seinen Säbel zum Angriff.
Die Begeisterung mit der die Kinder spielen, sich gegenseitig zu verletzten und zu töten, löste bei uns Beklommenheit aus. Wieso stört es die Erwachsenen nicht, wenn ihre Kinder zu Soldaten werden?
Scheinbar friedlich erleben die Großen und Kleinen die Idee des gerechten und edlen Kampfes und tauchen in ein harmloses, aber befriedigendes, womöglich sogar therapeutisches Kriegsspiel ein.
Der Geist, der zum 200. Jubiläum der Völkerschlacht geweckt wurde, lebt von der Lust, ab 15 Euro Eintritt den Nervenkitzel von Krieg kosten zu dürfen - ohne ihn tatsächlich erleben zu müssen. Das Rollenspiel der Erwachsenen ist aber ein verkapptes Spiel, weil sie die Emotionen, die die Vorstellung im Kampf zu sein, bei ihnen auslösen, hinter einem vorgeschobenem historischen Interesse verbergen. Die Gefahr dabei ist, dass sowohl Erwachsene als auch Kinder mit einem positiven Kriegstrauma die Gedenkwoche verlassen.
Gleichzeitig sind es Kinder, die den Geist des Militarismus auf Gefühlsebene entlarven. Sie weinen und schreien, wenn Kanonendonner in der Dunkelheit die Luft zum Zittern bringt. Sie spüren das Grauen dieser Kriegsspiele und davon berührt fragten wir uns, warum lebendige Geschichte eigentlich militant sein muss? Warum marschieren die todbringenden und gleichzeitig todgeweihten Körper in ihren Uniformen statt auf ein Schlachtfeld nicht auf einen symbolischen Friedhof um ihre Waffen, Abzeichen und Uniformen niederzulegen?
Das Erinnern an Krieg ist möglich, ohne den Geist des Militarismus wiederzubeleben, wenn lebendige Geschichte Zivilisten statt Soldaten hervorbringt. Wenn Frieden die Botschaft der Gedenkwoche sein soll, dann muss ein lebendiges Bewusstsein für Frieden und Achtung vor Körpern zum Leben erweckt werden. Statt dessen werden aber die Apparate, Geisteshaltungen und Verhaltensweisen, die erdacht wurden sind, um möglichst viele Körper in möglichst kurzer Zeit im Namen des Geistes einer Nation, eines Königs oder eines Volkes zu töten, zur Schau gestellt und verehrt.
Solange es lebendiger Geschichtsdarstellung darum geht, welche Seite mit welchen Waffen und cleveren Taktiken welchen Sieg errang und welche Wichtigkeit das für den Fortgang der Geschichte hat, wird der Geist des Militarismus zum Leben erweckt.
Friedemann Ebelt ist Ethnologe, Filmemacher und Medienwissenschaftler. Er lebt in Halle an der Saale. Die Ethnologin, Journalistin und Filmemacherin Theresa George lebt in Hamburg.
SIEHE AUCH:
Die Schlacht im Teutoburgerwald und die Relevanz von antiker Ethnologie







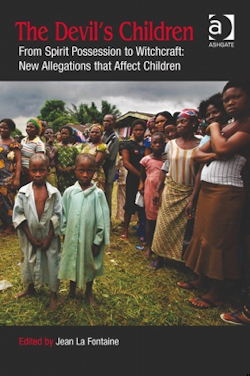
Neueste Kommentare